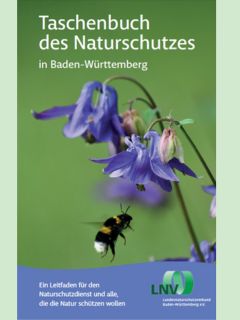Fachgespräch „Biotopgrünland und Beweidung“ 1.7.2020 in Donaueschingen
Begrüßung durch Gerhard Bronner/LNV-Vorsitzender als Einladendem
Es gibt Hinweise, dass auch strikt nach Naturschutzvorgaben bewirtschaftetes Grünland an ökologischem Wert verliert und Gräser dominieren. Eine Rolle könnte dabei eine nicht angepasste Nutzung spielen, die beispielsweise von einer fehlenden Vornutzung geprägt ist. Zur Klärung und Diskussion möglicher Konsequenzen wurde dieses Fachgespräch anberaumt.
Präsentation Alois Kapfer
Alois Kapfer forscht seit Jahrzehnten über die Nutzungsgeschichte des Grünlands Mitteleuropas und hat hierzu in 2010 grundlegende Ergebnisse publiziert. Danach bestanden in dem weit über Mitteleuropa hinaus verbreiteten Bodennutzungssystem der Dreizelgenwirtschaft (meist als Dreifelderwirtschaft bezeichnet) bis um 1800 im wesentlichen nur 3 verschiedene Wiesen-Nutzungstypen auf den bis damals noch nicht gedüngten Wiesenstandorten:
– Einschnittige Heuwiesen und
– zweischnittige Öhmdwiesen mit frühem Heuschnitt (Anfang Juli, Ende Juni) auf nährstoffreichen Standorten sowie
– einschnittige Herbstwiesen mit spätem Heuschnitt (September / Ende August) auf mageren Standorten.
Zusätzlich zu den Schnittnutzungen wurden diese Wiesen vom frühen Frühjahr bis Anfang Mai / Ende April vorbeweidet und um späten Herbst bis zum ersten Schneefall nachbeweidet. Auf der Heuwiese wurde statt des wachstumsmäßig möglichen Öhmdschnitts eine Sommerweide durchge-führt. Die Beweidung erfolgte durch das während der gesamten Vegetationsperiode gemeinschaftlich ausgetriebene Dorfvieh in Hütehaltung (mit Hirten). Es bestanden somit auf jeder Wiese 3 (Herbst-wiese) bzw. 4 Nutzungsgänge (Heu-, Öhmdwiese).
Die Nutzungsart einer Wiese (Heuwiese, Öhmdwiese, Herbstwiese) war rechtlich festgelegt und konnte vom Bewirtschafter nicht individuell abgeändert werden. Im Zuge der Modernisierung der Landwirtschaft mit Einführung der ganzjährigen Stallhaltung wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahr-hunderts zuerst die Frühjahrsvorweide aufgegeben, im Laufe des 20. Jahrhundert wurden – bei Auf-rechterhaltung der ansonsten noch „traditionellen“ Nutzungsgänge – auch die übrigen Weidegänge meist aufgegeben.
Das Naturschutzideal (FFH-Wiesen: wenig gedüngte 1-2schnittige Heuwiese mit später erster Nut-zung und ohne Beweidung) ist mehr oder weniger willkürlich herausgegriffen (pflanzensoziologische Erstbeschreibung 1926).
Historische Analysen sowie Beobachtungen der Praxis zeigen, dass Grünland, das im März/April vorbeweidet wurde, artenreicher ist. Werden die Gräser früh abgefressen, haben die Kräuter mehr Chancen zur Entwicklung. Zusätzlich verlängert sich (ohne Ersatzdüngung) der für das Aufwachsen eines erntefähigen Heuschnitts erforderliche Zeitraum. Gibt es keine Tiere, kann die Vorweide durch einen Schröpfschnitt (bis ca. 10 cm Aufwuchshöhe) nachgeahmt werden.
Beweidung hat nicht nur Vorteile für den Reichtum an Pflanzenarten. Durch den Dunganfall werden Nährstoffkreisläufe geschlossen und es entsteht eine Nahrungsbasis für Insekten, die wiederum Vö-gel ernähren. Zahlreiche Insektenarten wie Zikaden, Heuschrecken und Laufkäfer profitieren von Beweidung.
Die Erkenntnisse des Referenten stießen nach der Publikation vor zehn Jahren auf großes Interesse, der Autor wurde zu Vorträgen eingeladen
Geändert hat sich jedoch bislang fast nichts. Förderprogramme wurden nicht angepasst, in FFH-Managementplänen wird Beweidung für FFH-Wiesen i.d.R. nicht empfohlen, Vorweide wird nur selten erwähnt. In vielen Schutzgebietsverordnungen wird Beweidung ausgeschlossen. ebenso. In der Naturschutzstrategie werden extensive Weidesystem zwar als auszubauen genannt, geschehen ist aber noch zu wenig.
An die Präsentation schließt sich eine Diskussion zur Rolle der Beweidung von Wiesen sowie der extensiven Beweidung allgemein an.
Diskussion
Die Darstellung Alois Kapfers wird in ihren Grundzügen von allen Anwesenden geteilt.
Im Naturschutz gab es hinsichtlich des Schutzes der FFH-Mähwiesen lange Zeit Leitsätze, deren em-pirische Basis von einigen Anwesenden angezweifelt wird.
– (möglichst) keine Düngung (auch nicht P und K)
– Wiese ist besser als Weide
– möglichst später erster Schnitt
Sie basieren auf der realen Beobachtung, dass viele artenreiche Wiesen durch Intensivierung ökolo-gisch entwertet wurden, also durch starke Düngung, frühen und häufigen Schnitt (Silagewiesen statt Heuwiesen), oder aber durch intensive oder ausschließliche Beweidung. Dieser Prozess dauert bis heute an und ist weiterhin Ursache von Verlusten von FFH-Wiesen. Beobachtung wurde (unzulässig) verallgemeinert und wird. Dennoch ist eine Verallgemeinerung und generelle Ablehnung von Weide-gängen, wie sie teilweise in Naturschutzkreisen noch vertreten wird, nicht sachgerecht,
Dass eine Kombination von Mahd und Beweidung eine geeignete Maßnahme darstellt, um FFH-Wiesen in ihrem Charakter zu erhalten, hat u.a. auch Florian Wagner in seiner Dissertation nachge-wiesen. Er schlägt ein Konzept mit zwei Hauptnutzungen vor, von denen eine eine Beweidung ist. Weide ist jedoch nicht gleich Weide. Für normalerweise gemähtes Grünland ist eine kurze, intensive Weidephase am passendsten, also keine langfristige Standweide. Dies entspricht dem holistischen Weidemanagement („mob grazing“).
Berichtet wird, dass in einem Kreis beim Vertragsnaturschutz auf FFH-Wiesen Beweidung durch die UNB strikt abgelehnt wird, selbst auf Flächen, die nach ihrer Einschätzung nie anders genutzt wur-den oder die heute nicht anders sinnvoll genutzt werden können (Steillagen).
In Förderprogrammen sollte Vorweide und Schröpfschnitt in der Regel a) zugelassen und b) geför-dert werden. Diese Maßnahmen sind mit deutlichem Mehraufwand für den Landwirt verbunden und deshalb nicht kostenneutral möglich. Es soll möglichst große zeitliche Flexibilität herrschen (Aus-nahme: Bodenbrüter). Denkbar wäre z.B. einfach „Ruhezeiten“ zwischen einzelnen Nutzungen fest-zulegen (z.B. 6/8 Wochen zwischen Vornutzung und erster Hauptnutzung).
In Anlehnung an die ehemalige „Herbstwiese“ mit langer Vorweide bis Mitte Mai und späten Schnitt im September könnte auch der Schröpfschnitt vergleichsweise spät im Sinne einer frühen ersten Hauptnutzung erfolgen (z.B. Mahd zum Zeitpunkt der ersten Silagenutzung und dann ein später zweiter Schnitt). Das verlagert die Blütezeit in den Sommer, wenn sonst eher ein Mangel an Blüten besteht. Außerdem erfolgt dann der 2. Schnitt zu einem Zeitpunkt, wenn Vögel und Insekten ihren Reproduktionszyklus vollständig abgeschlossen haben. Der Futterwert des Schnittgutes ist in der Re-gel höher als bei einem späten ersten Schnitt (ohne Vornutzung). Ist eine Vorweide (mit all ihren sonstigen Wirkungen auf die Biodiversität) nicht möglich, so wäre ein solches Mahdregime eventuell ein guter Kompromiss zwischen Ökologie und Ökonomie (siehe Papier Weyers).
Es kommt der Einwand, dass große Flexibilität bedeuten kann, dass die Maßnahmeneinhaltung schwer kontrollierbar ist. Es wird als großes Problem angesehen, dass beim Design von landwirt-schaftlichen Förderprogrammen weniger die Sinnhaftigkeit der Maßnahme im Vordergrund steht als vielmehr die „Controllability“.
Notfalls muss auf die EU-Förderung verzichtet und nur durch das Land finanziert werden.
FFH-Managementpläne (MaP) sind zwar für den Bewirtschafter nicht verbindlich, die Empfehlun-gen werden aber sehr ernst genommen, da bei Verschlechterungen Sanktionen drohen. Von der Runde wird gewünscht, dass auch in den MaP, die Beweidung (insbesondere die Vorweide und Nachweide) als Bewirtschaftungsmaßnahme für FFH-Mähwiesen aufgeführt wird. Es wird dann aber erforderlich sein, dem Bewirtschafter klarzumachen, dass ein sehr gutes Weidemanagement erforder-lich ist (siehe WAGNER).
Relevant für die Bewirtschaftung von FFH-Grünland ist vor allem auch das Aulendorfer Merkblatt.
Es ist tendenziell beweidungskritisch und betont die späte erste Nutzung, also keine Vorweide und kein Schröpfschnitt. Dies sollte modifiziert werden.
Es wird diskutiert, inwiefern Forschung nötig ist. Grundsätzlich wird der Nachweis der Sinnhaf-tigkeit einer Vornutzung als ausreichend belegt angesehen, im Hinblick auf eine frühe erste Mahd mit dann sehr später zweiter Mahd gibt es jedoch kaum Erkenntnisse. Forschung und Entwicklung wäre außerdem erforderlich, um Integrierbarkeit in landwirtschaftliche Betriebsabläufe zu testen.
Da es in der Naturschutzverwaltung (und im Naturschutz generell!) noch wenig Wissen über die Vorbeweidung gibt, sind Schulungsmaßnahmen erforderlich. Fast noch wichtiger ist jedoch, die Vor-weide bei der Wiesennutzung auch in der landwirtschaftlichen Beratung zu verankern. Das Thema bietet sich an für die ohnehin vorgesehenen gemeinsamen Schulungen für Naturschutz- und Land-wirtschaftsverwaltung.
Es wird auch diskutiert, stärker Ergebnisse statt Maßnahmen zu fördern. Damit hat der Landwirt mehr Gestaltungsspielraum, aber auch Verantwortung. Das wird grundsätzlich befürwortet. Aller-dings hat die bisherige ergebnisorientierte Förderung (FAKT FFH-Wiesen, Blümleswiesen) noch keinen Durchbruch gebracht.
Es wird die die Idee eingebracht, statt eines Schutzes der Einzelfläche eher die regionale Bilanz an FFH-Wiesen in den Fokus zu nehmen (analog Elsass). Es stellt sich freilich die Frage, mit welchen Mechanismen gesichert werden kann, dass keine negative Bilanz entsteht und wie die Lasten unter den Betrieben verteilt werden. Wäre ein Kreisbauernverband bereit, hier Garantien zu übernehmen? Zudem ist ein „Floaten“ bei FFH-Wiesen schwer vorstellbar, da sowohl der Verlust wie vor allem auch der Neuaufbau ein mehrjähriger Prozess ist.
Die Ausbreitung von Giftpflanzen in Pflegeflächen (z.B. Herbstzeitlose), die dann mühsam bekämpft werden müssen, könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit durch eine Vornutzung reduziert werden.
Die Anwesenden wollen in ihren jeweiligen Bezügen an diesem Thema weiterarbeiten.
gez. Gerhard Bronner